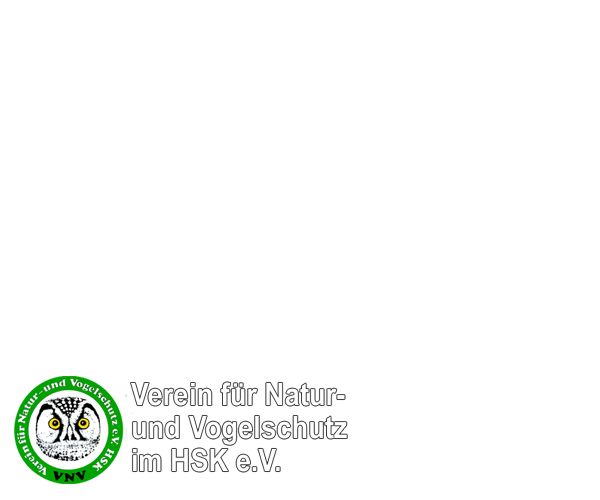Fachbeitrag aus Natur in NRW 1/2024
Neben der Klimakrise erfordert die Biodiversitätskrise besondere Aufmerksamkeit von Politik und Gesellschaft.
Die Roten Listen – Gradmesser für den Zustand der Natur – bieten dafür mit ihren Gefährdungsanalysen
und Handlungserfordernissen wesentliche wissenschaftlich fundierte Grundlagen. Sie
benennen die Arten, für die besondere Anstrengungen zur Verbesserung ihrer Bestandssituation erforderlich
sind. Für die Vögel gibt es seit Anfang der 1970er-Jahre in Deutschland Rote Listen. Bereits 1972
wurde die erste Rote Liste der Vögel für Nordrhein-Westfalen veröffentlicht (Mebs 1972). Jetzt haben die
Nordrhein-Westfälische Ornithologengesellschaft (NWO) und das LANUV die 7. Fassung der Roten Liste
der Brutvögel des Landes vorgelegt.
Wesentliche Grundlage der neuen Roten Liste der Brutvögel Nordrhein-Westfalens sind die Daten, die das Land für den nationalen Vogelschutzbericht 2019 zur Umsetzung der EU-Vogelschutzrichtlinie zur Verfügung gestellt hat. Das sind im wesentlichen Bestandszahlen, Trends und Verbreitungsangaben zum Bezugsjahr
Diese Daten wurden für die Rote Liste von Regionalkoordinatorinnen und -koordinatoren zusätzlich für die Großlandschaften des Landes ermittelt. Letztlich beruhen diese Daten auf der Feldarbeit von über 1.000 ehrenamtlichen und beruflichen Vogelkundlerinnen und Vogelkundlern, für deren Engagement wir sehr
dankbar sind.
Für die Gefährdungsanalyse wurden die bundesweit gültigen Kriterien für Rote Listen der Vögel (Haupt et al. 2020) für alle regelmäßig in Nordrhein-Westfalen brütenden heimischen Vogelarten angewandt.
Dazu dient ein Einstufungsschema, das auf den definierten Parametern Bestandsgrößenklasse, langfristiger (letzte 50 bis 150 Jahre) und kurzfristiger Bestandstrend (letzte 24 Jahre) beruht und eine Einstufung jeder Art in eine der Gefährdungskategorien erlaubt. Zusätzlich wurde geprüft, ob Risikofaktoren, wie etwa zukünftig mögliche klimawandelbedingte Austrocknung von Brutgewässern oder eine prognostizierte Zunahme von Störungen an Brutplätzen, vorliegen. Wenn begründet zu erwarten ist, dass sich der kurzfristige Bestandstrend in den nächsten zwölf Jahren aufgrund solcher Risikofaktoren verschlechtert, kann dies zur Einstufung der Art in eine höhere Gefährdungskategorie führen.
Gefährdete Arten in Nordrhein-Westfalen
Derzeit brüten 166 heimische Vogelarten regelmäßig in Nordrhein-Westfalen,
24 Arten sind in unserem Bundesland ausgestorben.
90 Arten (47 % dieser 190 Arten) sind nicht gefährdet, davon stehen neun auf der Vorwarnliste. Literaturrecherchen ergaben, dass mit Schlangen- und Steinadler zwei Arten in der Kategorie „ausgestorben“ in die Rote Liste gekommen sind, die bis ins 19. Jahrhundert in Nordrhein-Westfalen als Brutvögel vorkamen, was bisher nicht berücksichtigt worden war (Schmitz 2021).
In der Kategorie 1 („vom Aussterben bedroht“), der höchsten Gefährdungsstufe der derzeit im Lande brütenden Arten, finden sich 23 Arten. Die Turteltaube musste aufgrund anhaltender sehr starker Bestandsrückgänge von Kategorie 2 in der letzten Fassung der Roten Liste in Kategorie 1 hochgestuft werden. Der im Bestand wieder zunehmende Raubwürger konnte dagegen in Kategorie 2 abgestuft werden.
16 Arten werden in Kategorie 2 („stark gefährdet“) geführt. Hier finden sich mit Lachmöwe und Tannenhäher zwei Arten, die in der Roten Liste von 2016 noch „ungefährdet“ waren.
24 Vogelarten gelten in der Roten Liste als „gefährdet“ (Kategorie 3). Von diesen Arten war die Weidenmeise bisher „ungefährdet“, Teichhuhn, Rohrweihe und Rohrammer standen 2016 in der Vorwarnliste. Beim Schwarzstorch ist die Bestandsentwicklung wieder rückläufig, sodass die 2016 in „ungefährdet“ zurückgestufte Art nun wieder als „gefährdet“ eingestuft werden musste.
In der Kategorie R („extrem selten“) sind 13 Vogelarten mit in etwa stabilen Beständen enthalten, die aufgrund ihrer Seltenheit besonders anfällig gegenüber Gefährdungen sind. Die Steppenmöwe brütet erst seit wenigen Jahren in NRW.
In der Vorwarnliste stehen neun Arten, die in der nächsten Roten Liste als „gefährdet“ eingestuft werden müssen, wenn die Bestände weiter oder erneut abnehmen. Der in den letzten Roten Listen als „ungefährdet“ eingestufte Teichrohrsänger wurde neu in diese Kategorie aufgenommen. Der Waldlaubsänger galt in der Vorgängerliste als „gefährdet“, der Gartenrotschwanz als „stark gefährdet“.
Mehr als die Hälfte der Brutvogelarten ist gefährdet
100 Arten wurden somit einer Gefährdungskategorie, von „ausgestorben“ bis „extrem selten“, zugeordnet. Damit sind 53 Prozent der Brutvogelarten ausgestorben oder gefährdet, das sind sieben Arten mehr als in der Vorgängerliste (2016 waren es 49 %). Zunahmen gegenüber 2016 gab es vor allem in der Zahl der „stark gefährdeten“ Arten (Kategorie 2, von 14 auf 16) und bei den „gefährdeten“ Arten (Kategorie 3, von 21 auf 24). 83 Arten galten 2016 als „ungefährdet“ (ohne Arten der Vorwarnliste), jetzt sind es 81. Neun Arten konnten gegenüber 2016 in eine geringere, zwölf mussten in eine höhere Gefährdungsstufe eingeordnet werden. Damit hat sich die Situation der nordrhein-westfälischen Brutvogelwelt gegenüber der Roten Liste von 2016 verschlechtert.
Unverändert finden sich besonders viele gefährdete Arten in den Hauptlebensräumen Offenland (Agrarlandschaft)
und Sonderstandorte (Heiden, Moore). So nehmen Arten wie Rebhuhn, Kiebitz, Feldlerche und Feldsperling weiterhin deutlich ab (Grüneberg et al. 2021). Auch die Arten der Feuchtwiesen wie Uferschnepfe und Bekassine geben weiterhin Anlass zu großen Sorgen (siehe auch Beckers et al. 2021). Besonders stark sind die Abnahmen ferner bei der einst weit verbreiteten Turteltaube, für die nach neueren Zahlen von einem Bestand unter 1.000 Paaren ausgegangen wird. In den anderen Hauptlebensräumen Wald, Siedlung und Gewässer finden sich deutlich
geringere Anteile gefährdeter Arten. Im Wald gelten insbesondere spezialisierte Arten, darunter Schwarzstorch und
Tannenhäher, als gefährdet. Es ist zu befürchten, dass mit dem Haselhuhn schon in der nächsten Fassung der Roten Liste eine weitere Art als ausgestorben eingestuft werden muss, da bereits seit einigen Jahren keine gesicherten Nachweise mehr vorliegen. Beim Grauspecht lassen Bestandszuwächse in jüngster Zeit dagegen auf eine Bestandserholung hoffen. Inwieweit sich das großflächige Absterben von Nadelwäldern, bedingt durch Trockenheit
und Käferkalamitäten, auf die Brutvogelwelt auswirkt, wird die Zukunft zeigen. Weiterhin müssen von den Arten der Städte und Dörfer einige Arten als gefährdet eingestuft werden. Dazu zählen Rauch- und Mehlschwalbe, aber auch der sogar stark gefährdete Girlitz, der inzwischen weite Teile seines nordrhein-westfälischen Verbreitungsgebietes im Tiefland geräumt hat. Auch von den Arten der Gewässer finden sich etwa zwei Drittel in
einer Gefährdungskategorie, sodass die Situation auch in diesem Lebensraum besorgniserregend bleibt. Gefährdet sind einige Enten wie Knäkente, Löffelente und Krickente, aber auch die Wasserralle und das Blaukehlchen. Hier dürfte zukünftig die Austrocknung von Brutgewässern infolge des Klimawandels, wie in den letzten Jahren bereits vielerorts beobachtet, zur weiteren Gefährdung der Brutvögel führen.
Handlungsbedarf (nicht nur) in der Agrarlandschaft
Aus den Gefährdungseinstufungen ergibt sich nach wie vor dringender Handlungsbedarf, vor allem in der Agrarlandschaft. Im Ackerland gilt es, in Zusammenarbeit mit den Landnutzenden den Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden weiter zu reduzieren und vermehrt extensiv oder ungenutzte Flächen und Streifen sowie Feldvogelinseln anzubieten. Hier finden Vögel ausreichend Nahrung und Deckung. Diese Maßnahmen kommen auch Insekten und anderen Tieren sowie Ackerwildkräutern zugute. Die Angebote des Vertragsnaturschutzes
spielen hierbei eine besonders wichtige Rolle (Thiele 2020). In den Grünlandgebieten kommt es auf einen
wiesenvogelfreundlichen Wasserhaushalt bei extensiver Nutzung und ein Prädatorenmanagement zur Minimierung der Verluste von Gelegen und Jungvögeln gefährdeter Arten an, was bislang in vielen Wiesenvogelschutzgebieten
nicht konsequent umgesetzt wird (Jöbges et al. 2024). In Nordrhein-Westfalen gilt es dabei zusätzlich, die laufenden LIFE-Projekte für den Wiesenvogelschutz konsequent umzusetzen (Brüning & Herkenrath 2023).
Gefährdete Arten im Wald profitieren besonders vom Erhalt und der Entwicklung alter Laub- und Mischwälder mit hohem Alt- und Totholzanteil, wie es in Teilen der Staatswaldfläche, im Nationalpark Eifel, in Naturwaldzellen und in Wildnisgebieten der Fall ist. Bei der Neubegründung von Wäldern auf Kalamitätsflächen gilt es, Artenschutzgesichtspunkte besonders zu berücksichtigen. An Gewässern kommt es auf verstärkte großräumige Renaturierungen bei der weiteren Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie sowie den Erhalt und die
Neuschaffung von Röhrichten an. Das am Bienener Altrhein laufende LIFE-Projekt „Lebendige Röhrichte“ des Naturschutzzentrums im Kreis Kleve zeigt exemplarisch, wie dies erfolgreich umgesetzt werden kann.
In Städten und Dörfern gilt es neben anderem, Brutplätze von Mauersegler, Haussperling und Mehlschwalbe bei der energetischen Sanierung von Gebäuden zu sichern oder neu zu schaffen und Grünflächen wie Parks und Friedhöfe naturnah zu gestalten.
Dass sich Maßnahmen des Artenschutzes lohnen, zeigen erfolgreiche Projekte und Maßnahmen, die zu lokalen Bestandszunahmen gefährdeter Arten geführt haben. So werden Grauammern verstärkt wieder außerhalb ihres Kernvorkommens in den linksrheinischen Börden festgestellt. Das Braunkehlchen zeigt in gut gemanagten
EU-Vogelschutzgebieten im Mittelgebirge stabile bis zunehmende Bestände. Raubwürger und Grauspecht zeigen lokale Bestandszunahmen und in jüngster Zeit nimmt landesweit der Bestand des Wendehalses wieder zu. Flussrenaturierungen erlauben es Arten wie der Uferschwalbe und dem Flussregenpfeifer, sich anzusiedeln.
Letztere profitieren auch von Maßnahmen der Abgrabungsindustrie zum Erhalt der Brutplätze.
Gefährdet sind viele Zugvögel, darunter viele Langstreckenzieher. Das sind Arten, die südlich der Sahara überwintern. Ein Paradebeispiel ist die Turteltaube, die neben der Beeinträchtigung ihrer Lebensräume auch unter exzessiver Bejagung auf dem Zug und in den Überwinterungsgebieten leidet. Immerhin gibt es neuerdings
Jagdmoratorien für die Turteltaube in vielen Ländern im Mittelmeerraum. Die EU-Vogelschutzrichtlinie verpflichtet
die Mitgliedstaaten dazu, dass die Jagd auf Vögel Anstrengungen, die in ihrem Verbreitungsgebiet zu ihrer Erhaltung unternommen werden, nicht zunichtemacht (Artikel 7). Diese Bestimmung wird für eine Reihe von Arten konterkariert; so dürfen neben der Turteltaube auch andere gefährdete Arten wie Kiebitz, Bekassine, Waldschnepfe, Uferschnepfe und Feldlerche in einigen EU-Mitgliedstaaten bejagt werden. Eine besondere Rolle kommt der Umsetzung von internationalen Artenaktionsplänen zu, wie dem für die Turteltaube (Fisher et al. 2018). Es ist jedoch unbestritten, dass für den Schutz dieser Arten insbesondere Anstrengungen in den Brutgebieten notwendig sind. Nordrhein-Westfalen verfügt derzeit über 28 Vogelschutzgebiete, die nach der EU-Vogelschutzrichtlinie ausgewiesen wurden. Von vielen gefährdeten Arten beherbergen diese Gebiete den Großteil des Bestandes im Lande, etwa bei Trauerseeschwalbe, Uferschnepfe, Wachtelkönig, Wiesenweihe, Blaukehlchen, Braunkehlchen
und Wiesenpieper. Bei den Vogelschutzgebieten kommt es auf die langfristige Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes der wertgebenden Vogelarten an. Ein wichtiges Instrument dafür sind die Vogelschutz-Maßnahmenpläne, die die Behörden für die Gebiete erarbeiten. Hier ist eine konsequente Umsetzung geboten.
Die gefährdeten Brutvogelarten gelten in Nordrhein-Westfalen als planungsrelevant. Planungsrelevante Arten sind eine fachlich begründete Auswahl geschützter Arten, die bei einer Artenschutzprüfung im Sinne einer Art-für-Art-Bearbeitung einzeln betrachtet werden müssen (MKULNV 2016). Die neue Rote Liste bedeutet, dass Teichhuhn, Steppenmöwe, Tannenhäher, Weidenmeise und Rohrammer nun als planungsrelevant gelten. Die erforderlichen Gegenmaßnahmen, um den Zustand der Vogelwelt in Nordrhein-Westfalen zu verbessern, sind seit Langem bekannt und werden von haupt- und ehrenamtlichen Akteurinnen und Akteuren im Naturschutz angewendet. Sie reichen jedoch nicht aus, um die insgesamt negative Entwicklung umzukehren. Neben dem Schutz der Lebensräume ist
auch eine Wiederbelebung gezielter Artenhilfsmaßnahmen erforderlich, die in der Vergangenheit bei einigen Arten wie Weißstorch, Uhu und Wanderfalke sehr erfolgreich waren. Die Rote Liste der Brutvögel Nordrhein-Westfalens zeigt deutlich, dass verstärkte Bemühungen im Naturschutz beziehungsweise im gezielten Schutz der Vogelarten notwendig sind, um Artenschwund und Bestandsrückgänge aufzuhalten und umzukehren, gemäß dem Ziel der Biodiversitätsstrategie des Landes, den Anteil gefährdeter Arten bis 2025 auf 40 Prozent zu reduzieren (MKULNV
2015).
Literatur
Beckers, B., Ikemeyer, D., Herkenrath, P. & R. Tüllinghoff (2021): Feuchtwiesenschutzgebiete:
Zustand in Nordrhein-Westfalen. Natur in NRW 1/2021: 10–15.
Brüning, I. & P. Herkenrath (2023): Zwei Jahre LIFE-Projekt Wiesenvögel NRW. Projektbausteine
und erste Umsetzungen. Natur in NRW 1/2023: 11–17.
Fisher, I., Ashpole, J., Scallan, D., Proud, T. & C. Carboneras (compilers; 2018): International
Single Species Action Plan for the conservation of the European Turtle Dove Streptopelia turtur
(2018 to 2028). European Commission, Brussels.
Grüneberg C., Herkenrath P. & M. M. Jöbges (2021): Aktuelle Bestandssituation der Brutvögel
Nordrhein-Westfalens. Beitrag zur Datengrundlage für den nationalen Vogelschutzbericht 2019.
Charadrius 57: 131–164.
Grüneberg, C., Sudmann, S. R., Herhaus, F., Herkenrath, P., Jöbges, M. M., König, H., Nottmeyer,
K., Schidelko, K., Schmitz, M., Schubert, W., Stiels, D. & J. Weiss (2016): Rote Liste der Brutvogelarten Nordrhein-Westfalens, 6. Fassung, Stand: Juni 2016. Charadrius 52: 1–66.
Haupt, H., Bauer, H.-G., Hüppop, O., Ryslavy, T., Sudfeldt, C. & P. Südbeck Nationales Gremium Rote Liste Vögel: Methodik der Gefährdungsanalyse für die Roten Listen der Brutvögel mit Hinweisen zur Handhabung. Unveröffentlichtes Manuskript für die Rote-Liste-Ländergremien. 27 S.
Jöbges, M. M., Beckers, B., Brüning, I., Frede, M., Graf, M., Härting, C., Herkenrath, P., Ikemeyer, D., Klostermann, S., Tecker, A., Sudmann, S. R. & R. Tüllinghoff (2024): Erhaltungssituation und Schutzgebietsmanagement für Wiesenvögel in Nordrhein-Westfalen – Bilanz und Perspektiven. Charadrius 60 (im Druck).
Mebs, T. (1972): Rote Liste der gefährdeten Brutvögel Nordrhein-Westfalens. Anthus 9: 16–18.
MKULNV Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW: Biodiversitätsstrategie NRW. Düsseldorf.
MKULNV Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW: Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Artenschutz bei Planungs- oder Zulassungsverfahren (VV-Artenschutz).
Runderlass vom 06.06.2016.
Schmitz, M. (2021): Haben Schlangenadler Circaetus gallicus, Schreiadler Clanga pomarina und Steinadler Aquila chrysaetos bis ins 19./20. Jahrhundert in Nordrhein-Westfalen gebrütet? Charadrius 57: 43–52.
Sudmann, S. R., Schmitz, M., Grüneberg, C., Herkenrath, P., Jöbges, M. M., Mika, T., Nottmeyer, K., Schidelko, K., Schubert, W. & D. Stiels (2021, publiziert 2023): Rote Liste der Brutvogelarten Nordrhein-Westfalens, 7. Fassung,
Stand: Dezember 2021. Charadrius 57: 75–130.
Thiele, U. (2020): Vertragsnaturschutz in NRW – Bilanz und Herausforderungen. Natur in NRW 4/2020: 18–23.
AUTOREN UND AUTORIN
Peter Herkenrath, Christoph Grüneberg, Michael M. Jöbges
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz
NRW (LANUV) Recklinghausen
peter.herkenrath@lanuv.nrw.de
christoph.grueneberg@lanuv.nrw.de
michael.joebges@lanuv.nrw.de
Stefan R. Sudmann, Michael Schmitz, Klaus Nottmeyer
Nordrhein-Westfälische Ornithologengesellschaft Bad Honnef
sterna.sudmann@t-online.de
mich.schmitz@gmx.de
nottmeyer@nw-ornithologen.de
Tobias Mika
Biologische Station Rhein-Berg
mika@bs-bl.de
Kathrin Schidelko
Darius Stiels
Stiftung Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels (LIB) Bonn
k.schidelko@leibniz-lib.de
d.stiels@leibniz-lib.de
Werner Schubert
Biologische Station Hochsauerlandkreis
Brilon
w.schubert@biostation-hsk.de
Downloads: